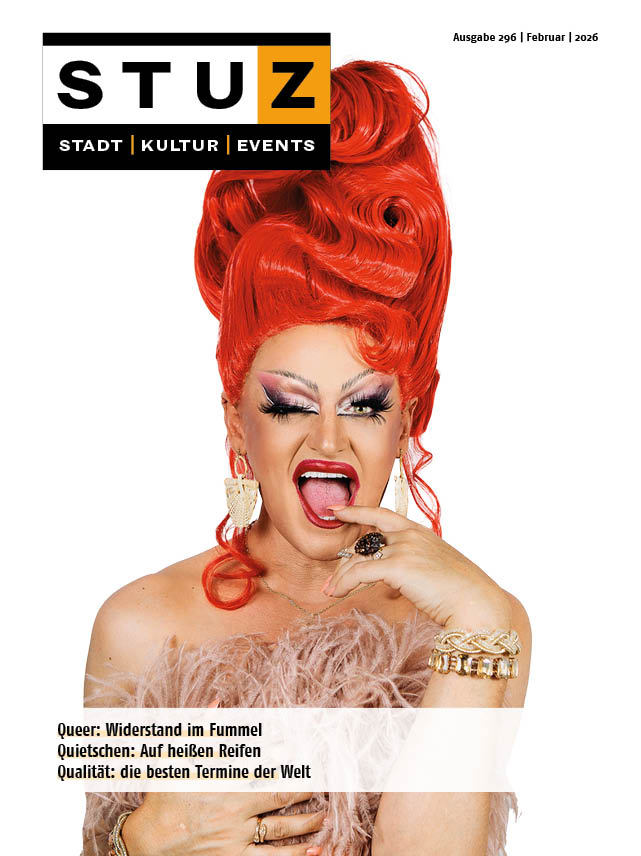Ein Falter zum schwärmen

Was kreucht und fleucht im STUZ-Gebiet? Wilde Tiere vor der Haustür, Teil 55: Das Taubenschwänzchen
von Konstantin Mahlow
Ein in der Luft stehendes Tier, das seine Flügel so schnell schlägt, als wäre es ein Schmetterling auf Amphetaminen, während es mit seinem überdimensionalen Rüssel genüsslich den Blütennektar eines Lavendels aussaugt. Nicht wenige dachten beim ersten Anblick des Taubenschwänzchens: Das muss ein Kolibri sein – und das auch noch hier auf meinem Balkon. Doch der NABU und andere konnten das Missverständnis aufklären. Das Taubenschwänzchen (Macroglossum stellatarum) ist ein tagaktiver Schmetterling aus der Familie der Schwärmer. Wie viele andere Wirbellose kommt er dank des Klimawandels immer häufiger im STUZ-Gebiet vor und verdient es, genauer in den Blick genommen zu werden: Der Exot ist ein Falter der Superlative – in gleich mehrfacher Hinsicht.
Mit einem Namen, der klingt wie der Spitzname eines mittelalterlichen Minnesängers, fliegt das flinke Insekt auf beinahe surreal wirkende Weise mit 70 bis 90 Flügelschlägen pro Sekunde durch die nachbarschaftlichen Blumenbeete. Wie die erwähnten Kolibris ist es in der Lage, durch das In-der-Luft-stehen und dank schneller Flügelschläge Nektar aus Blüten zu saugen, ohne sich dabei abzusetzen – das ist der sogenannte Schwirr- oder Rüttelflug. Dann verschwindet es mit einer blitzartigen Bewegung wieder. Sein Name leitet sich von seinem kurzen Hinterleib ab, der an den eines Vogelschwanzes erinnert. Für einen Falter wirkt das Taubenschwänzchen mit einer Flügelspannweite von vier bis fünf Zentimetern relativ groß. Die Vorderflügel sind grau-braun gemustert, während die orangefarbenen Hinterflügel beim Flug gut sichtbar sind. Zu verwechseln ist es eigentlich nicht, höchstens vielleicht mit der sogenannten Gamma-Eule – einer weiteren Falterart, die nicht nur einen außergewöhnlichen Namen besitzt, sondern ebenfalls einen Kolibri-ähnlichen Flugstil.
Taubenschwänzchen sind Wanderfalter, die aus dem Mittelmeerraum zu uns kommen und in den letzten Jahren in zunehmender Zahl auch bei uns überwintern. Die überwinternden Falter sorgen dann für reichlich Nachwuchs, der zusätzlich zu den eintreffenden Exemplaren durch Gärten und Parks schwirrt. So erhöht sich ihre Zahl Jahr für Jahr. Als wärmeliebende Art haben sie sich bisher vor allem an Rhein, Main und Neckar etabliert, ziehen aber auch unbeirrt weiter nach Norden. In Mainz und Wiesbaden sind sie längst häufige Besucher blumenreicher Anlagen, wo man sie in Ruhe bei ihrem geschäftlichen Treiben beobachten kann. Am liebsten laben sie sich an nektarreiche Arten wie Lavendel, Petunien oder Zinnien. Deren Blühen im Garten erhöht die Chancen auf einen Besuch der Schwänzchen.
Erstaunlich ist nicht nur ihr Schwirrflug, sondern auch ihre grundsätzlichen Fähigkeiten im Flug: Nicht nur, dass Taubenschwänzchen bis zu 2.000 Kilometer auf ihrer Wanderschaft zurücklegen können und dabei auch mal in Skandinavien landen, im Gegensatz zu anderen Arten fliegen sie selbst bei starkem Wind oder im Regen scheinbar mühelos. Und im Gegensatz zu den meisten anderen Schwärmern sind sie tagsüber und in der Dämmerung unterwegs. Aber wie bei allen Faltern, beginnt auch das Leben der Taubenschwänzchen nicht als Flugkünstler, sondern als kriechende Raupe. Ausgewachsen erreichen diese eine Länge von etwa vier bis fünf Zentimetern. Sie sind meist leuchtend grün gefärbt, haben eine feine, weiße Seitenlinie und auf dem Rücken kleine gelbliche Punkte. Typisch für Schwärmer-Raupen ist das deutlich sichtbare, gebogene „Analhorn“ am hinteren Ende, das beim Taubenschwänzchen meist bläulich oder violett gefärbt ist.
Die Raupen schlüpfen aus kleinen, grünen Eiern, die das Weibchen einzeln auf den Blättern ihrer bevorzugten Futterpflanzen ablegt – besonders auf Labkräutern wie dem namensgebenden Echten Labkraut. Je mehr Taubenschwänzchen hier überwintern und Eier legen, umso mehr Raupen schlüpfen in der nächsten Saison. Voraussetzung ist das Ausbleiben von Frost – das mögen die Schwänzchen gar nicht. Die Bedingungen scheinen, menschengemacht, dafür sowieso immer besser zu werden. Und dann wird es auch mehr „Kolibri-Sichtungen“ geben.
Foto: Charles J. Sharp, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons