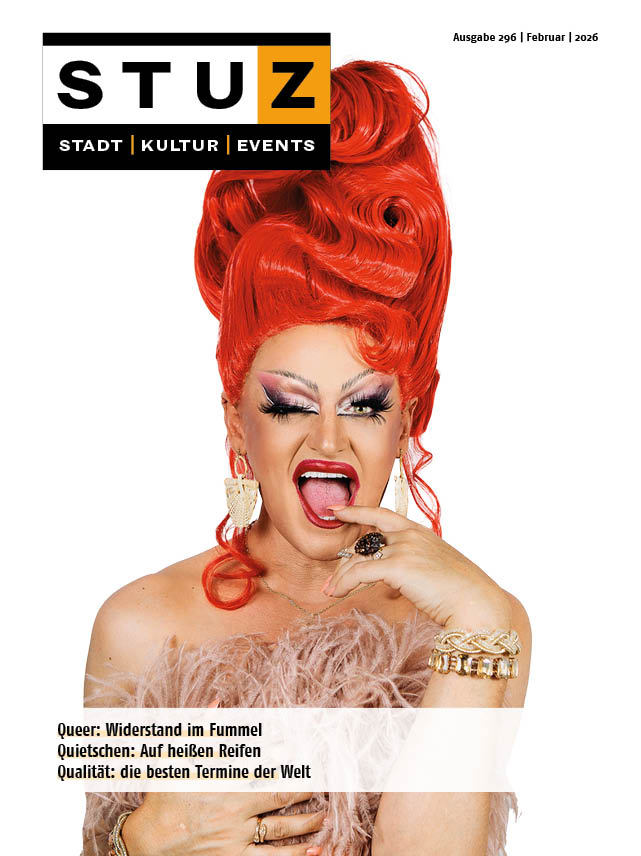Beatnik im Beton

Was kreucht und fleucht im STUZ-Gebiet? Wilde Tiere vor der Haustür, Teil 56: Die Bachstelze
von Konstantin Mahlow
Ja, wir müssen mal wieder über den Zollhafen reden. Oder in diesem Fall lesen, wenn die bisherigen 55 Tiere in dieser Kolumne noch nicht das Interesse nach den wilden Mitbewohnern im STUZ-Gebiet erschöpft haben sollten. Zu gut lässt sich auf dem Gelände in der Mainzer Neustadt die (Rück-)Entwicklung städtischer Natur wie auch die langsam einsetzende Besiedlung eines vermeintlich lebensfeindlichen Habitats durch eine Handvoll trotziger Tierarten beobachten. Immer wieder entdecken aufmerksame Besucher:innen zwischen den verdurstenden Bäumen und den endlosen Pflastersteinwüsten die eine oder andere bemerkenswerte Spezies – etwa den hier schon vorgestellten Hausrotschwanz und den Eisvogel. Seit einigen Jahren hat eine weitere Vogelart den Umzug in die gehobene Wohngegend gewagt und offenbar erfolgreich gemeistert: die Bachstelze.
Die Bachstelze (Motacilla alba) ist eine von vier Stelzen in Deutschland und im Vergleich zu ihren mit strahlend gelben Brustfedern ausgestatteten Verwandten eher unscheinbar. Zu verwechseln ist der trotz des Farbmangels ästhetische Singvogel mit seinem kontrastreichen, schwarz-weiß-grauen Gefieder dennoch nur mit Sehschwäche. Schon von weitem sind sein arttypisches Wippen mit dem Schwanz und der bogenförmige, von Auf- und Abwärtsbewegungen geprägte Flug zu erkennen. Doch in der Luft ist die Bachstelze weniger zu Hause als andere Vögel. Sie bevorzugt es, trippelnd auf dem Boden zu schreiten und von unten nach Nahrung Ausschau zu halten. Mit kurzen Fangflügen stürzt sie dann nach oben, um Fluginsekten zu erbeuten. Wenn die Bachstelze zu Fuß unterwegs ist, bewegen sich Kopf und Schwanz rhythmisch zu ihren Schritten, was von außen betrachtet manchmal so wirkt, als würde sie beim Laufen Airpods tragen und zum Beat nicken.
Offenes Terrain bevorzugt
Bachstelzen sind hierzulande häufig und bewohnen verschiedene Lebensräume. Besonders gerne halten sie sich auf offenen, spärlich bewachsenen Flächen in Ufernähe auf – als ob der Zollhafen extra für ihre Bedürfnisse konzipiert worden sei. Immerhin kann man sich hier vor spärlich bewachsenen Flächen kaum retten. Von Vorteil für die Bachstelzen dürften auch die nun nach und nach verschwindenden Brachflächen auf den Baugeländen gewesen sein. Heute sieht man sie häufig im Bereich der kleinen Brücke an der Hafeneinfahrt, wo sich links und rechts langsam kleine Auenwälder etablieren, wenn auch noch in bescheidener Buschhöhe. Zwischen den Ufersteinen finden sie eine ihrer liebsten Speisen: Flohkrebse – kleine, bis zu zwei Zentimeter große Krebstiere, deren Verwandte auch als Plankton in den Ozeanen vorkommen. Häufiger erbeuten Bachstelze allerlei Arten von Insekten und deren Larven, Würmer, Schnecken und Spinnen.
Sieht man mal keine Bachstelzen im Zollhafen, kann man sie oft dennoch hören. Das hohe Zi-Lipp oder Dschi-Witt ist genauso typisch wie der groovige Gang. Ihr Nest bauen die wenig scheuen Vögel gerne in Mauernischen, Fensterbänken und künstlichen Nisthilfen, von wo aus sie einen guten Blick über die Umgebung haben. Man könnte den Bachstelzen also schnell näher sein, als einem lieb ist. Im Herbst machen sie dann allerdings den Abflug nach Südwesteuropa und Nordafrika und kommen ab Mitte März wieder – die Männchen etwa zwei Wochen vor den Weibchen, um schon mal die Reviere untereinander aufzuteilen.
Noch sind Teile des Zollhafens mit ihren Brachflächen und einem scheinbar guten Insektenangebot perfekt für die Bachstelze. Aber auch wenn die letzten leeren Flächen mit neuen Apartments und Büros zugebaut sein werden, hat sie innerhalb des Hafengeländes gute Chancen, sich zu halten. Das soll aber nicht unbedingt als eine Empfehlung zur Vogelsafari im Zollhafen verstanden werden. Den häufig vorkommenden Bachstelzen kann man nicht nur im Grauen, sondern praktisch auch überall im Grünen begegnen, solange Wasser in der Nähe ist. Und das ist dann für Seele und Verstand doch besser, als zwischen Beton gegrillt zu werden. Auch wenn manche Vögel das wohl anders sehen.
Stephan Sprinz, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons